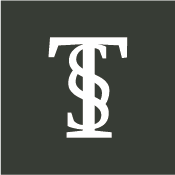E-Scooter im Straßenverkehr – rechtlich unterschätzt?
Seit Jahren gehören elektrisch betriebene Cityroller zum Stadtbild. Doch was passiert, wenn E-Scooter unsachgemäß genutzt werden oder gar in strafrechtlich relevante Situationen geraten?
Gerade im Zusammenhang mit § 315d StGB (vgl. Bundestagsdrucksache (18/12964 v. 28.06.2017)) stellt sich die Frage, ob E-Scooter überhaupt als Kraftfahrzeuge im Sinne des Gesetzes gelten und damit als Tatmittel infrage kommen.
Der folgende Beitrag fasst die wesentlichen Erkenntnisse des Aufsatzes von RA Torsten Schmidt (Potsdam) und Nina Poppitz (stud. jur.) zusammen.
Warum E-Scooter juristisch relevant sind
E-Scooter sind längst ein fester Bestandteil des Straßenverkehrs. Mit ihnen steigt jedoch auch die Zahl an Verkehrsverstößen und Unfällen. Strafrechtlich besonders interessant wird es, wenn E-Scooter in Situationen eingesetzt werden, die § 315d StGB betreffen – also verbotene Kraftfahrzeugrennen oder rücksichtsloses Fahren mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.
Damit stellt sich die Kernfrage: Sind E-Scooter überhaupt Kraftfahrzeuge im Sinne des Strafgesetzbuchs?
Einordnung als Kraftfahrzeug
Nach § 1 II StVG sind Kraftfahrzeuge Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.
Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) definiert E-Scooter ausdrücklich als Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb, einer Höchstgeschwindigkeit von 6 bis 20 km/h und einer maximalen Nenndauerleistung von 500 Watt.
Damit überschreiten sie die für Elektrofahrräder geltenden Leistungsgrenzen. Sowohl Rechtsprechung als auch Literatur ordnen E-Scooter deshalb überwiegend als Kraftfahrzeuge ein – was bedeutet, dass § 315d StGB (vgl. Bundestagsdrucksache (18/12964 v. 28.06.2017)) grundsätzlich anwendbar wäre.
Das Gefährdungspotenzial
Im Vergleich zu Fahrrädern sind E-Scooter schwerer, beschleunigen schneller und reagieren empfindlicher auf Straßenunebenheiten.
Gerichte wie das LG München I oder das OLG Zweibrücken weisen darauf hin, dass diese Eigenschaften das Unfall- und Verletzungsrisiko deutlich erhöhen.
Andere Stimmen betonen dagegen, dass die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von nur 20 km/h eher für eine Gleichbehandlung mit Fahrrädern spricht.
Das tatsächliche Gefährdungspotenzial liegt also zwischen Fahrrad und Kraftrad und genau das macht die juristische Einordnung schwierig.
Was § 315d StGB eigentlich bezweckt
§ 315d StGB wurde 2017 eingeführt, um illegale Straßenrennen mit Pkw und Motorrädern härter zu bestrafen.
Im Gesetzgebungsverfahren war jedoch nie die Rede von E-Scootern oder anderen Elektrokleinstfahrzeugen – sie existierten damals schlicht noch nicht im Straßenverkehr.
Heute führt die Einordnung der E-Scooter als Kraftfahrzeuge dazu, dass ihr Gebrauch im Extremfall denselben Strafrahmen wie das Fahren eines Pkw im illegalen Rennen auslösen kann – eine Gleichbehandlung, die angesichts des deutlich geringeren Gefährdungspotenzials unverhältnismäßig erscheint.
Mein Fazit
Die aktuelle Gesetzeslage führt dazu, dass E-Scooter unter § 315d StGB (vgl. Bundestagsdrucksache (18/12964 v. 28.06.2017)) fallen – obwohl sie weder dem Zweck noch der Gefährlichkeit klassischer Kraftfahrzeuge entsprechen.
„Mit der Erfassung von E-Scootern als Tatmittel des § 315d StGB wird der Gesetzeszweck überdehnt. Eine teleologische Reduktion oder zumindest ein minder schwerer Fall wäre sachgerechter.“
– RA Torsten Schmidt
Für die Praxis bedeutet das: Gerichte sollten das geringere Gefährdungspotenzial berücksichtigen. Auch eine Anpassung des Gesetzes, um Elektrokleinstfahrzeuge differenzierter zu behandeln, wäre überfällig.
Vollständiger Fachaufsatz
Den vollständigen Aufsatz mit allen Nachweisen und Rechtsprechungszitaten finden Sie hier:
> E-Scooter als Tatmittel im Rahmen des § 315d StGB – PDF ansehen
Kontaktieren Sie uns jederzeit unter der Telefonnummer 0331 585 07 41 – wir beraten Sie gern!
Sie haben einen ähnlichen Fall? Dann vereinbaren Sie einen Termin für eine Erstberatung bei Torsten Schmidt.